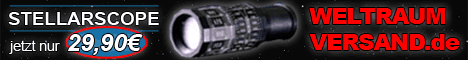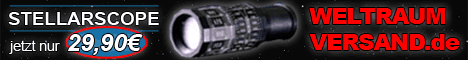|
Nova erwartet, Komet am Abendhimmel
Reiner Boulnois
Volkssternwarte Marburg e.V.
Im Frühlingsmonat April erreicht die Sonne stetig nördlichere Bereiche ihrer Jahresbahn, wodurch sich bei uns im Monatsverlauf der lichte Tag um fast zwei Stunden verlängert. Die Sonne wechselt dabei nach der Monatsmitte vom Tierkreissternbild Fische zum Widder. Der 25. Aktivitätszyklus mit voraussichtlich elf Jahren Dauer zeigt auf unserer Sonne erwartungsgemäß kurz vor dem Maximum zunehmende Anzahlen von Sonnenflecken und Protuberanzen. Auch die von Zeit zu Zeit von Deutschland aus sichtbaren Polarlichter sind direkte Folgen dieser Aktivitätszunahme. Am 8. April findet eine leider nur in Nordamerika beobachtbare totale Sonnenfinsternis statt.
Am 10. April findet man unseren Erdtrabanten als schmale zunehmende Sichel mit auffälligem Erdlicht in der Abenddämmerung in der Nähe des Riesenplaneten Jupiter, in dessen näherer Umgebung sich auch Planet Uranus und der Komet 12P/Pons-Brooks aufhalten. Am folgenden Abend steht die Mondsichel vor dem "Goldenen Tor der Ekliptik". So wird die Himmelsregion zwischen dem auffälligen Sternhaufen der Plejaden (= Siebengestirn) und dem weiter gestreuten Sternhaufen der Hyaden nahe beim roten Hauptstern Aldebaran im Sternbild Stier genannt. Am 13. April findet man unseren zunehmenden Halbmond in der nahezu größten Nordbreite, zehn Vollmonddurchmesser höher als die Sonne zur Sommersonnenwende steht.
In diesem wieder einmal sehr planetenarmen Monat sind der sonnennahe Planet Merkur, die Nachbarplaneten Venus und Mars und, außer vielleicht bis auf die letzten Monatstage, auch Saturn für das bloße Auge unsichtbar. Selbst der bisher am Abendhimmel strahlende Riesenplanet Jupiter gerät zunehmend in Sonnennähe, steht daher in der Abenddämmerung über dem Nordwesthimmel und wird ab Monatsende kaum noch freiäugig aufzufinden sein. Der Vorübergang am Planeten Uranus am 20. April, wobei dieser etwa im Abstand von einem Vollmonddurchmesser nördlich steht, kann nur mit optischen Geräten beobachtet werden. Gewissermaßen als Übergabe beginnt dafür ab dem Monatsende, allerdings zunächst in der hellen Morgendämmerung, eine neue Sichtbarkeitsphase des Ringplaneten Saturn, die bis über das Jahresende andauern wird.

Wieder einmal ist ein leicht auffindbarer Fernglas-Komet am Abendhimmel zu verfolgen. Unter besten Sichtbarkeitsbedingungen nach Nordwesten wird man ihn auch mit bloßem Auge als Nebelfleck, vielleicht sogar mit Schweifansatz nach links oben, wahrnehmen können. Er ist über die Osterfeiertage in der Nähe von Hamal, dem hellsten Stern im Tierkreissternbild Widder aufzufinden. Der Komet wird Sonntag (Sommerzeit!) noch rechts, am Ostermontag schon links von diesem Stern in Ferngläsern sichtbar sein. Er wird sich bis Mitte April, etwa in Richtung des Planeten Jupiter, rasch weiter bewegen und danach, südlich von diesem, nur noch schwer in der Abenddämmerung wahrnehmbar sein.
Die seit Jahresanfang als Blickfang dienenden Wintersternbilder mit ihrer Vielzahl an auffällig hellen Sternen sind nun im Westen in Horizontnähe gerückt und werden ab Monatsende im Strahlungsbereich der näher rückenden Sonne verschwinden. Währenddessen dominieren nun die auffälligsten Frühlingssternbilder Löwe, Bootes oder "Bärenhüter" und Jungfrau mit ihren hellen Sternen Regulus, Arktur und Spica, den Südhimmel in bester Beobachtungsposition. Sie bilden das recht ausgedehnte sogenannte Frühlingsdreieck. Am Frühjahrshimmel können wir aus unserer Milchstraße in den Himmelsregionen um das Frühlingsdreieck relativ ungestört in das Weltall hinausblicken und damit die erheblich sternreicheren, größeren, aber entfernteren Objekte beobachten. Damit werden Galaxien und Kugelsternhaufen in den Sternbildern Löwe, Jungfrau, Haar der Berenike, Jagdhunde und Großer Bär zu bevorzugten teleskopischen und fotografischen Beobachtungsobjekten.
An das Sternbild Bootes mit dem auffälligen rötlichen Riesenstern Arktur schließt sich das leicht aufzufindende Halbrund der Nördlichen Krone mit nur einem recht hellen Stern an. Unterhalb dieser Sternanordnung ist in der allernächsten Zeit ein Nova-Ausbruch zu erwarten. Dort steht ein sehr lichtschwaches Doppelsternsystem aus einem Roten Riesen und einem Weißen Zwerg mit der Bezeichnung T CrB, das gerade noch in einem guten Fernglas wahrgenommen werden kann.

Es handelt sich hierbei um eine der sogenannten seltenen wiederkehrenden Nova-Ereignisse, bei denen in regelmäßigen Zeiträumen, im vorliegenden Fall alle 80 Jahre, ein Helligkeitsausbruch um einen Faktor von etwa 10.000 eintritt. Denn von einem ausgedehnten Riesenstern geht beständig ein Materiestrom in Richtung eines sehr dichten weißen Zwerges aus, der dann dieses Material aus einer Scheibe auf seine Oberfläche zieht. Ist genügend Wasserstoff auf der Oberfläche angekommen, zündet eine kurzfristige Kernfusion, wobei Helium gebildet wird. Dabei entsteht so viel an Strahlungsenergie, dass das Doppelsternsystem ähnlich hell wie Gemma, der hellste Stern in der Krone, erscheint. Solche Nova-Erscheinungen sind seit Jahrtausenden als sogenannte "Neue Sterne" (= Novae) beobachtet und dokumentiert worden.
Das auffällige Sternenband der Milchstraße mit ihren eingestreuten hellen Stern- und dunklen Staubwolken zieht sich von Südwesten nach Nordosten und ist in klaren Abendstunden ohne Mondlicht im ersten Monatsdrittel gut beobachtbar. Auch das noch lichtschwächere Band des Zodiakallichts, am Staub reflektiertes Sonnenlicht, erstreckt sich vom Westhorizont bis zum Jupiter entlang der Ekliptik.
| andere Himmelsansichten | nach oben | Sternhimmelarchiv |
|